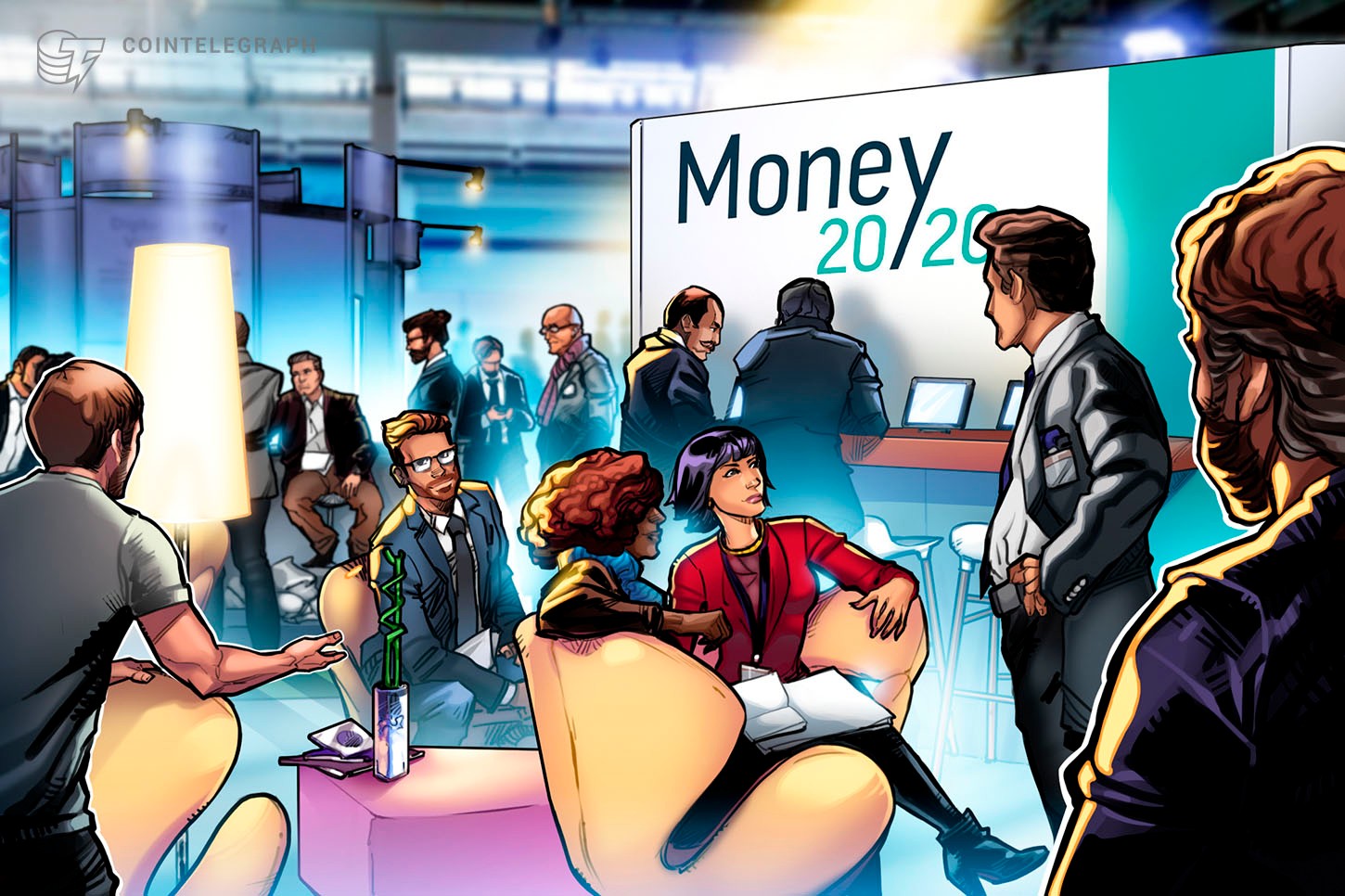Die Wege der Welt der Kryptowährungen und der Welt des Bankwesens kreuzten sich erneut auf der Money20/20-Konferenz in Europa vom 4. bis 6. Juni.
Fintech-Unternehmen und Finanzdienstleister trafen sich auf der Konferenz, um über Geld und Technologie zu sprechen - insbesondere darüber, wie sie effizienter zusammenarbeiten können.
Seitdem Kryptowährungen in den Mainstream eingetreten sind, vor allem aufgrund eines Ausbruchs im Jahr 2017, können sowohl die Fintech- als auch die Finanzbranche die Möglichkeiten der Blockchain-Technologie und der digitalen Währungen nicht mehr ignorieren.
Ein besonderes Highlight des Vorzeigeprojektes Money20/20 Europe war eine Diskussionsrunde mit dem Titel "Cryptocurrency, the central (bank) question". Vier prominente Persönlichkeiten der Bank von England, der Bank von Kanada, der Bank von Litauen und der Schweizer Nationalbank waren anwesend.
Diese vier Institutionen haben einen unglaublichen Einfluss darauf, wie die Welt Geld betrachtet und vor allem auf die Geldpolitik in ihren jeweiligen Ländern.
In den letzten Jahren mussten sich Zentralbanken und Finanzinstitute mit dem Aufkommen von Kryptowährungen und deren stetig wachsender Akzeptanz weltweit auseinandersetzen. Vor einigen Jahren war ihre Verbreitung noch gering, aber das hat sich erheblich geändert.
Im Jahr 2018 sind einige der einflussreichsten Zentralbanken der Welt dabei, sich Kryptowährungen und das, was sie gerne als Distributed-Ledger-Technologie (DLT) bezeichnen, anzusehen.
Die meisten haben harte Haltungen gegenüber Bitcoin und anderen Kryptowährungen eingenommen, aber wie dieses Money20/20-Diskussionsforum zeigt, ändert sich das langsam auf der ganzen Welt.

Money20/20, “Cryptocurrency, the central (bank) question” Diskussionsforum, Amsterdam, Niederlande
Martin Etheridge – Bank von England
Die Bank von England war in den letzten Jahren in ihrer Haltung gegenüber Kryptowährungen im Allgemeinen besonders heikel. Trotzdem begann die Bank von England in letzter Zeit, ihre Meinung zu ändern, und kündigte eine Kryptowährungs-Task Force an, die den Sektor eingehend erforschen soll.
Darüber hinaus zeigte die Bank sich interessiert an der Technologie, die Bitcoin, DLT und Blockchain antreibt.
Martin Etheridge ist Abteilungsleiter bei der Bank von England und verantwortlich für Fintech. Er leitet auch den Banknotenbetrieb und beaufsichtigt die Arbeit der Bank im Bereich der digitalen Währungen.
Etheridge erklärte, wie die Bank von England ihre Haltung gegenüber Kryptowährungen seit ihrer ersten Ausgabe von zwei Berichten im Jahr 2014 langsam geändert hat:
"Wir kamen weitgehend zu dem Schluss, dass wir sie nicht als eine große Bedrohung für die Währungsstabilität angesehen haben. Wir haben damals im Jahr 2014 nicht erwartet, dass es für sie eine Massenakzeptanz im Massenzahlungsverkehr geben würde."
Obwohl die Verwendung von Kryptowährungen zugenommen hat, sagte Etheridge, dass es keine Pläne gebe, eine digitale Zentralbank-Währung einzuführen. Ihre letzte Überprüfung der Kryptowährungen im März 2018 ergab jedoch keine "Bedrohung für die Finanzstabilität", aber Etheridge sagte auch, dass es sich um einen Sektor handelt, den sie "sehr genau überwachen" würden.
"Wir sind uns bewusst, dass in einem verteilten System das Potenzial für Belastbarkeit und andere Vorteile von verteilten Zahlungssystemen vorhanden ist. Das wollen wir im Auge behalten und vollständig in die Arbeit integrieren, die wir derzeit an unserer eigenen Infrastruktur durchführen.
Etheridge zeigte auch, dass die Bank von England elektronische Verbindlichkeiten bei der Zentralbank in Form von Reservekonten ausgibt. Das ermöglicht Großhandelskunden die Abwicklung von Verbindlichkeiten über den Echtzeit-Bruttoabwicklungsservice (RTGS).
Dieses System wird derzeit überholt und die Bank arbeitet immer noch an der Technologie, die das überarbeitete RTGS antreiben soll.
"Es wird nicht auf DLT-Systemen basieren, aber wir erwarten und hoffen, dass es in der Lage sein wird, mit DLT-Systemen, die von der Privatwirtschaft entwickelt werden, zusammenzuarbeiten."
Etheridge war auch zuversichtlich, dass Kryptowährungen keine Gefahr für die langfristige Existenz von Fiatgeld darstellen.
"Ich sehe in der gegenwärtigen Iteration kein Potenzial dafür, dass Krypto-Vermögenswerte Fiatwährungen ersetzen." Wer weiß, was die Zukunft bringen wird, aber die Chancen stehen eher für Fiat gut. Es würde schon eine grundlegende Verschiebung der öffentlichen Wahrnehmung brauchen, damit das geschieht."
"Das ist eine sehr relevante Frage: Welche Währung wird in der Gesellschaft verwendet und verlassen sich die Leute auf die bestehenden Behörden, dass sie Geld-Funktionen zur Verfügung stellen, die sie für ihr tägliches Leben benötigen? Wenn sie es nicht tun, könnten sie sich nach Alternativen umsehen. Meiner Meinung nach ist das aktuell System nicht so brüchig, dass wir eine alternative Kryptowährung erwarten müssen, die die Fiatwährung in irgendeinem großen Rechtsgebiet ersetzt."

Money20/20, “Cryptocurrency, the central (bank) question” Diskussionsforum, Amsterdam, Niederlande
Dr Marius Jurgilas – Bank von Litauen
Dr. Marius Jurgilas ist Mitglied des Vorstands der Bank von Litauen. Jurgilas gilt als Experte für Fintech im Land und ist ein Vordenker, wenn es um die Zukunft des Bankensektors in Litauen geht.
Jurgilas sprach das Thema digitale Zentralbankwährung an, indem er erläuterte, wie Kryptowährungen überhaupt entstanden sind.
"Das Produkt, das wir (Banken) verkaufen, ist Vertrauen. Wenn unser Produkt gut ist, bräuchte man nicht über Kryptowährungen zu sprechen. Es ist eine Frage des Vertrauens. Ob wir der Institution vertrauen, die mit der Aufsicht über unsere Zahlungssysteme betraut ist, ob sie sicherstellt, dass das Geld nicht durch übermäßige Inflation beeinträchtigt wird. Denn dann sind Zahlungsinstrumente oder andere Mittel zur Wertspeicherung gar nicht nötig.
Aber wenn die Gesellschaft anfängt das in Frage zu stellen, sei es zu Recht oder zu Unrecht, oder wenn sie denkt, dass das, was wir verkaufen, besser gemacht werden könnte, auf eine bequemere und billigere Weise, werden andere Dinge in Erscheinung treten. Wir als Regulierungsbehörden müssen darauf reagieren - wir sind auf unseren Positionen nicht festgewachsen, denn die Arbeit, die jeder hier leistet, zeigt, dass wir wirklich aufmerksam sind."
Ein Punkt, der Jurgilas jedoch beunruhigt, ist die Möglichkeit, dass diese akzeptierten Kryptowährungen zu einem "großen Zusammenbruch" führen könnten. Das ist wohl auch der Grund dafür, "warum wir Warnungen herausgeben und auf die Risiken hinweisen".
Jurgilas nutzte das Aufkommen von Initial Coin Offerings (ICOs) in Litauen als Beispiel für die Bedenken der Aufsichtsbehörden.
"Erstens sind wir nicht sicher, ob diese Dinge ihre potenziellen Investoren wirklich über die Risiken aufklären. Zweitens betrachten wir das als Chance, Finanzierungsmöglichkeiten für wirklich riskante Geschäftsaktivitäten zu schaffen. Was ist der ultimative Risikokapitalunternehmer? Ein Investor, der bereit ist, 90 Prozent der Anteile zu verlieren, da 10 Prozent zu einer erheblichen Wertsteigerung führen werden?"
Er glaubt, dass die Zahl der ICOs beweist, dass Risikokapitalunternehmer bereit sind, erhebliche Risiken für Fintech-Ideen einzugehen. Das bedeutet, dass ein erheblicher Teil des Kapitals in Projekte fließen könnte, die eine größere Chance haben, erfolgreich zu sein.
"Wenn wir als Regulierungsbehörden diese Gelder in produktive Aktivitäten lenken könnten und nicht nur PR-Kampagnen für das nächste Projekt produzieren, könnte das den Wohlstand der Gesellschaft erhöhen."
James Chapman – Bank von Kanada
James Chapman hat, als selbsternannter "Nerd" auf der Konferenz, einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften und einen MSc in Statistik. Er ist Forschungsleiter der Bank von Kanada im Bereich Fondsverwaltung und Banking.
Chapman hat seinen Forschungsschwerpunkt in letzter Zeit auf Fintech verlagert und dabei Kryptowährungen und Blockchain-Technologie miteinbezogen.
Er hob hervor, dass die künftige Entwicklung einer digitalen Zentralbankwährung durch die Bedürfnisse der Öffentlichkeit bedingt sei. Auf die Frage, ob Kryptowährungen Fiatwährungen ersetzen könnten, war Chapman jedoch ziemlich pragmatisch:
"Ich glaube nicht, dass das passiert, solange die Zentralbanken weiterhin gute Arbeit bei der Aufrechterhaltung der Geldpolitik leisten. Aber könnte eine Kryptowährung wirklich das Ende der Fiatwährung bedeuten? Ich denke schon. In einer Hyperinflation-Situation, in der eine Zentralbank die Verantwortung für die Stabilität aufgegeben hat, könnte man einen Fall für Kryptowährung erkennen."
Thomas Moser – Schweizer Nationalbank
Mit einem breiten Aufgabenspektrum bei der Schweizerischen Nationalbank ist Thomas Moser stellvertretendes Vorstandsmitglied und stellvertretender Abteilungsleiter. Seine Abteilung beschäftigt sich mit Wirtschaft, Internationale Belange, Statistik, Recht und Kommunikation.
Mosers Einsichten sind vielleicht die interessantesten, wenn man bedenkt, dass das jüngste Referendum in der Schweiz das Ende des Partiellen Reservesystems im Land durch eine nationale Abstimmung im Juni bedeuten könnte.
Wie Moser erklärte, hat das Referendum seinen Ursprung in der Finanzkrise 2008 und "die Menschen haben einfach das Vertrauen in das Bankensystem verloren" und wollen es der Zentralbank zurückgeben.
Im Wesentlichen wären normale Banken nicht mehr in der Lage, Geld auszugeben, und die Menschen hätten Konten bei den Zentralbanken.
"Es gäbe verschiedene Möglichkeiten, das umzusetzen. Eine Möglichkeit wäre, dass die Zentralbank eine digitale Zentralbankwährung ausgibt. Eine weitere Möglichkeit ist die Eröffnung von Zentralbankkonten für alle direkt dort."
Die Volgelld-Initiative hat eine Ausarbeitung der vorgeschlagenen Reformen herausgegeben, das eine Bestimmung enthält, dass private Währungen erlaubt sind, solange sie das der Zentralbank erteilte Mandat nicht stören.
Laut Moser wurde das zum Schutz anderer privater Märkte, einschließlich Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoin, aufgenommen.
"Anwälte sagen, dies würde der Regierung zum ersten Mal die Möglichkeit geben, bestimmte Arten von privatem Geld auszuschließen. Man könnte das möglicherweise nutzen, um Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoin, zu verbieten."
Doch wie der Schweizer Bankier erklärt, unterstützt das Land seit langem schon Kryptowährungen, denn sein Massen-Transitzug-System ist 2016 zum Beispiel Bitcoin-freundlich geworden:
"Die Schweiz war relativ begeistert von Krypto. Wir haben ein nationales Eisenbahnsystem, das Fahrkartenautomaten in Bitcoin-Geldautomaten verwandelt hat. An jedem Bahnhof in der Schweiz können Sie Bargeld in einen Fahrkartenautomaten stecken und eine BTC-Wallet aufladen. Kryptowährungen wurden in der Schweiz bisher stark toleriert."
Hinsichtlich der Möglichkeit, dass Kryptowährungen Fiat verdrängen könnten, sagt Moser, das hänge ganz von der Effizienz der jeweiligen Zentralbank ab:
"Im Allgemeinen nicht, aber ich denke, es hängt von der Fiatwährung der Zentralbank ab. Wenn eine Währung natürlich nicht gut funktioniert, hat man eine Hyperinflation und ein Land, in dem Leute das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit seiner Zentralbank verlieren. Das hängt von der Zentralbank ab. Solange sie gute Arbeit leistet, gibt es keinen Grund, dass die Fiatwährung verschwindet."

Money20/20, Amsterdam, Niederlande
Keine Krypto-Gleichgültigkeit mehr
Das wichtigste, das man aus diesem Thema lernen kann, ist, dass die Zentralbanken beginnen, ihre Stimmung gegenüber Kryptowährungen zu ändern. Es gibt weit weniger Gleichgültigkeit gegenüber der Blockchain-Technologie. Das geht sogar so weit, dass Banken und Finanzdienstleister aktiv nach Möglichkeiten suchen, die Technologie zur Verbesserung ihrer Systeme einzusetzen.
Sie mögen den Leuten zwar nicht empfehlen, Bitcoin und andere Kryptowährungen zu verwenden, aber es scheint, dass sich in den kommenden Monaten und Jahren eine harmonischere Umgebung entwickeln könnte.