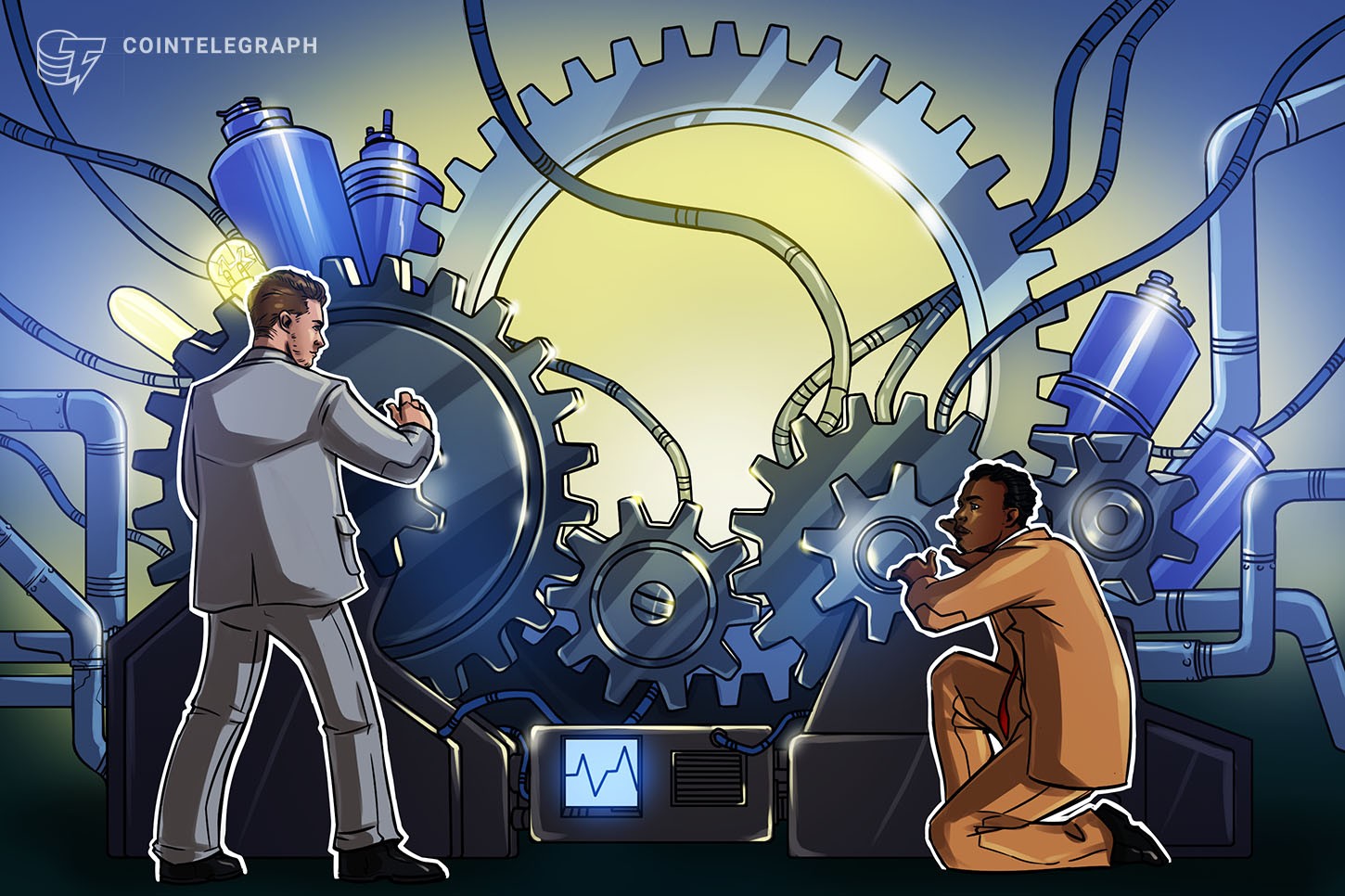Die Blockchain-Technologie erobert nach und nach immer mehr Industriezweige. Standen am Anfang vor allem Kryptowährungen und der Finanzsektor im Zentrum des Interesses, ist der reine Asset-Bereich mittlerweile nur noch ein Anwendungsfall von vielen, wenn auch der wohl verbreitetste.
Neben Unternehmen aus dem Logistiksektor, welche in mittlerweile zahllosen Projekten Blockchain-Anwendungsfälle erproben oder bereits umsetzen, hat auch der Energiesektor ein wachsames Auge auf die langsam erwachsen werdende Technologie geworfen. Denn wie in Lieferketten gibt es auch hier komplexe Netze mit vielen Einzelakteuren, Intermediären und Transaktionen, welche durch eine Dezentralisierung von Information und automatischen Abstimmungsmechanismen profitieren können.
In einer im Februar 2019 vorgelegten Studie hat die Deutschen Energie-Agentur (dena) umfassend herausgearbeitet, wie sich Blockchain-Technologie im Energiesektor schon heute einsetzen lässt. Für die Bereiche Finanzierung & Tokenisierung, Asset Management, Datenmanagement, Kommunikation und Handel ermittelte die dena folgende 11 konkreten Anwendungsfälle und bewertete diese nach dem jeweiligen “Grad der Erfüllung technischer Anforderungen” und dem erwarteten “ökonomischen Nutzen”.
Quelle: dena-Studie “Blockchain in der integrierten Energiewende”
Was die technischen Anforderungen betrifft, attestiert die dena in 10 von 11 Anwendungsfällen der Blockchain-Technologie schon heute einen mittleren bis hohen Erfüllungsgrad. Dass sich der Einsatz aber trotzdem noch nicht in allen Szenarien lohnt, macht ein Blick auf die Evaluierung des erwarteten ökonomischen Nutzens deutlich.
In den Bereichen “Mieterstrom”, “Shared Investments bei externem Mieterstrom “und “Abrechnung von Entgelten und Umlagen” ist der zu erwartende finanzielle Netto-Effekt möglicherweise noch nicht ausreichend groß, berücksichtigt man die allgemein doch sehr positive Einschätzung der dena.
Quelle: dena-Studie “Blockchain in der integrierten Energiewende”
Ergebnisse aus den mittlerweile zahlreichen Pilotprojekten im In- und Ausland dürften hier bald zusätzliche Klarheit bringen. Dabei sollten idealerweise komplett neu aufgebaute Laborprojekte für den Blockchain-Einsatz von in klassischen Netzen und Marktstrukturen umsetzbaren Anwendungsfällen unterschieden werden.
Ein solches Laborprojekt ist etwa das im Pfaff-Quartier in Kaiserslautern entstehende EnStadt:Pfaff-Projekt, welches als Leuchtturmprojekt den Blockchain-Einsatz für den automatisierten Handel von Energie zwischen verschiedenen Gebäuden, Erzeugern und Verbrauchern sowie bei Ladestationen für Elektromobilen testet.
Industrielle Großkonzerne und Netzbetreiber stehen vor der Herausforderung, Blockchain-Technologie in bestehende komplexe Systeme mit großer Infrastruktur und vielen Marktteilnehmern integrieren zu müssen.
Hierbei steht meist der dezentrale Datenaustausch im Mittelpunkt, um die Markttransparenz zu erhöhen und Intermediäre auszuschalten — mit dem Ziel einer effizienteren Allokation. Die Energy2market GmbH, einer der größten unabhängigen Stromhändler Deutschlands, hat sich zu diesem Zweck bereits 2018 mit dem Startup Swytch zusammengetan, um eine Blockchain-basierte Daten- und Anreizplattform für erneuerbare Energien entwickeln.
Der direkte Stromhandel gilt unter Energieversorgern laut einer dena-Studie mit einem Anteil von 60 Prozent als der aktuell häufigste Anwendungsfall. Das Ziel dabei: Marktakteure agieren auf direktem Weg miteinander ohne zentrale Instanzen wie Börsen, Broker oder Energieversorger und sparen dadurch Kosten.
Eine große Bedeutung kommt dabei neuen Blockchain-Plattformen zu, auf denen verschiedene Marktakteure miteinander direkt in Kontakt treten können. Dies kann etwa im Rahmen eines reinen Datenaustauschs geschehen oder durch neuen Marktstrukturen auf Basis von Kryptowährungen und -Token.
Dies hat auch der gerade im Kraftwerks-, Infrastruktur- und Netzbereich stark aufgestellte Siemens-Konzern erkannt. Dessen Abteilungen Energy Management und Power Generation Services arbeiten mittlerweile mit der Open-Source- und skalierbaren Blockchain-Plattform "Energy Web Foundation" (EWF) zusammen. In anderen Ländern setzt Siemens bereits Blockchain-Technologie in Microgrid-Steuerungslösungen ein, mit denen überschüssiger Strom wieder in das lokale Netz eingespeist und von Käufern bezahlt werden kann.
Dass sich solche Blockchain-Marktlösungen auch im regionalen und lokalen Kontext lohnen können, zeigt ein neues Projekt des deutschen Startup Stromdao, mit dem Anbieter und Nachfrager von Ökostrom ihre Einspeisung und Entnahme optimieren können. Mit einem durch Künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie optimierten Prognoseverfahren ermittelt Stromdao einen für Postleitzahlenbereiche auf Nachfrage- und Angebotsdaten basierenden Grünstromindex, mit dem sich sehr zeitabhängige Stromtarife realisieren lassen.
Auch große Industrieanlagen können von solchen Systemen profitieren. Der Hafen von Rotterdam, mit einer Länge von insgesamt 42 Kilometern Europas größter Hafen, will sein eigenes Elektrizitätswerk künftig durch eine mit dem Unternehmen S&P Global Platts zur Zeit entstehende Blockchain-Plattform effizient mit externen nachhaltigen Energiequellen abstimmen.
Vor einer umfassenden Blockchain-Energiewende gibt es aber nach wie vor einige Hindernisse zu meistern. Neben der technischen Expertise und dem Aufbau technischer Lösungen ist hierbei auch die Politik gefragt, wie auch die dena-Studie feststellt. So fehlen laut der dena bislang noch konkrete rechtliche Rahmenbedingungen vor allem im Umgang mit Krypto-Assets. Zudem müsse weiter geprüft werden, “inwieweit die Technologie und der sichere Aufbau digitaler Messinfrastruktur (Hardware) gut genug zueinander passen, um eine Ende-zu-Ende-Informationskette zu realisieren.”
Für Smart Contracts im Energiesektor fordert die dena zudem die Einrichtung eines Registers, “das vertragliche Sachverhalte der Energiewirtschaft aufnimmt und damit gleichzeitig als Ansatzpunkt für eine Ordnung derselben dient.” Das Aufsetzen einer solchen Plattform sollte “durch eine unabhängige Institution vollzogen werden, sie sollte frei zugänglich sein und die Einträge sollten permanent gesichtet, bewertet, diskutiert und kommentiert werden.”
Dass sich die geplante Blockchain-Strategie der Bundesregierung dies teilweise doch sehr spezifischen Forderungen umfassend berücksichtigen wird, ist jedoch fraglich. Deutschland hängt bei der rechtlichen Einstufung der Blockchain-Technologie anderen Ländern deutlich hinterher und wird sich sicherlich zunächst grundsätzlichen Fragen rund um Datensicherheit, Privatsphäre, Eigentumsrechten, Wertübertragungen und der definitorischen Einordnung von Distributed-Ledger-Technologien (DLT) und verschiedenen Token-Arten sowie Emissionsformen wie Initial Coin Offerings (ICO) und Security Token Offerings (STO) widmen.